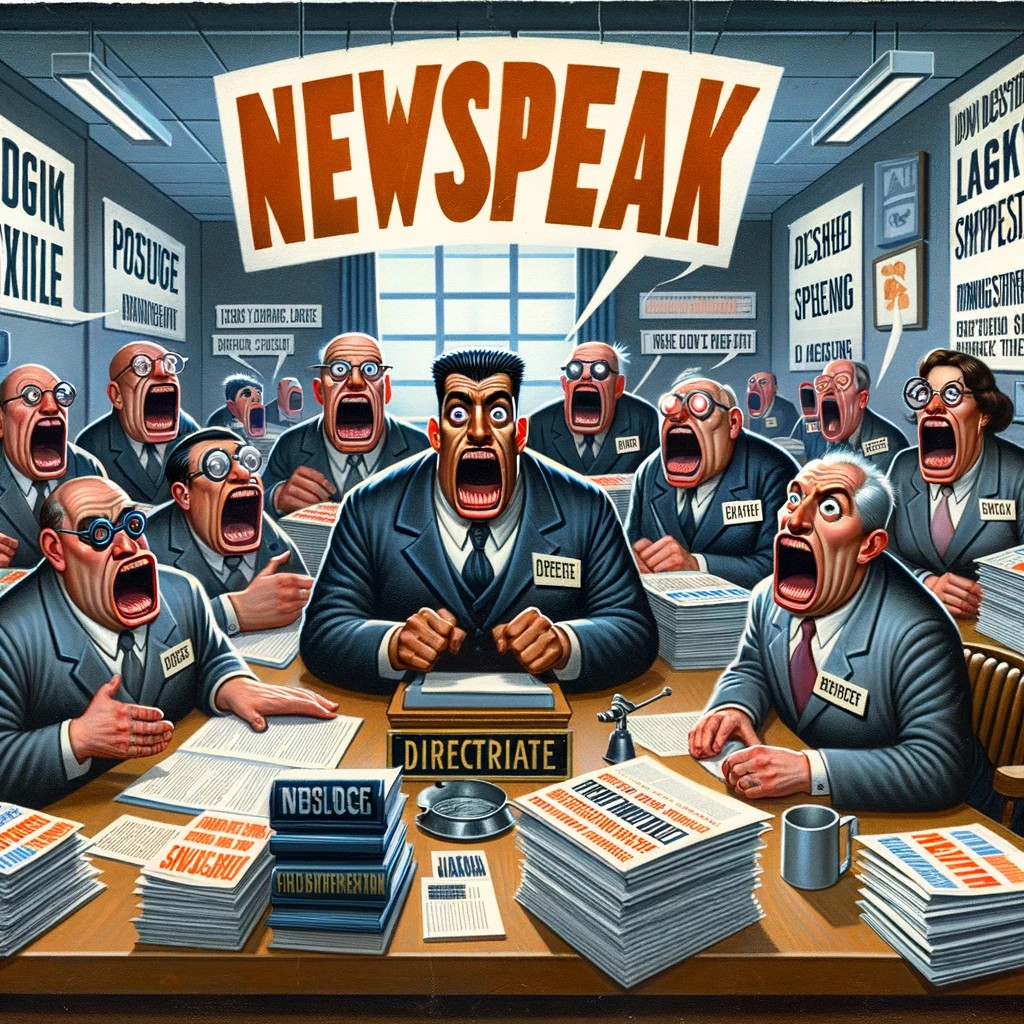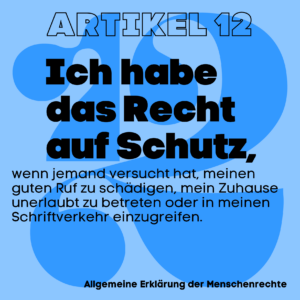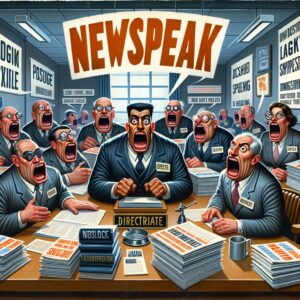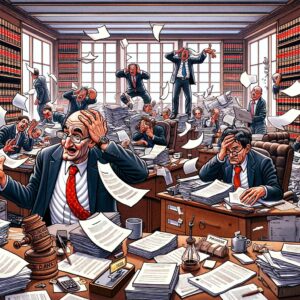Den Zurich Observer per Email erreicht hat heute jener Fragebogen, der als Herzstück des Schweizer „Octagon“-Systems dient, „um Risiken von vermeintlich gefährlichen Personen zu beurteilen“, wie es die Website algorithmwatch.org1 in ihrem Überblick über „Octagon“ formulierte. Den Fragebogen erstellt haben Jérôme Endrass und Astrid Rossegger. Wie steht es um dessen „Betriebssicherheit“? Haben sie damit Missbrauch Tür und Tor geöffnet?
Jérôme Endrass ist ein Schweizer Psychologe, Forensiker und Hochschullehrer. Er ist ausserplanmässiger Professor für Forensische Psychologie an der Universität Konstanz* und stellvertretender Leiter des Amtes für Justizvollzug und Wiedereingliederung des Kantons Zürich, wo er eine interdisziplinäre Forschungsgruppe leitet. Endrass ist bekannt für seine Forschungsarbeiten zur Risikoeinschätzung bei Gewalt- und Sexualstraftätern, zur Radikalisierung sowie zur Wirksamkeit forensischer Interventionen. (Wikipedia)
Astrid Rossegger (* 7. Dezember 1977) ist eine Schweizer Psychologin und Forensikerin. Sie ist Privatdozentin für Forensische Psychologie an der Universität Konstanz sowie stellvertretende Forschungsleiterin des Amtes für Justizvollzug und Wiedereingliederung des Kantons Zürich. Rossegger ist bekannt für ihre Forschung zu forensischen Risikoeinschätzung, Rückfallprävention und forensischen Interventionen, insbesondere im Bereich der Gewalt- und Sexualstraftaten sowie der Radikalisierung. (Wikipedia)
* Ebenfalls an der Universtität Konstanz lehrt der bekannte forensische Psychiater Frank Urbaniok, aktuell bekannt aus Funk und Fernsehen für seine Thesen zur kulturellen Prägung der Delinquenz; Vater des ebenfalls nicht unumstrittenen Präventivdiagnosesystems "FOTRES".
Beim Überfliegen des Octagon-Formulars (Version 3, 2019) sprang ins Auge, dass viele Fragen des Fragebogens zur korrekten Beantwortung eigentlich professioneller Fachkunde bedürften.
Es liegt auf der Hand, dass Polizeibeamte, Justizvollzugsbeamte und allenfalls Staatsanwälte mit dem Octagon-Formular fachlich und menschlich überfordert wären. Denn die meisten Fragen erfordern theoretische Kenntnisse, praktische Erfahrungen und menschliche Fähigkeiten aus dem Bereich Psychiatrie und Psychologie.
Missbrauch Tür und Tor geöffnet?
Auch ins Auge stach ein gewisses Missbrauchspotenzial einzelner Fragen. Zwar entstammen die meisten dem klinischen Kontext und zielen auf ein Assessment klinisch relevanter Sachverhalte ab. Doch sind die Wahrnehmungen der Beamten, die überhaupt zu einer Einschätzung führen, in den meisten Fällen nirgendwo festzuhalten. Nicht einmal ein konkreter Vermerk auf beiliegende Akten oder Aktenstellen ist in dem Formular vorgesehen. Außerdem könnten einzelne Fragen zur missbräuchlichen Pathologisierung objektiv gesehen berechtigter Anliegen und Interessen zweckentfremdet werden. Ohne Pflicht, die gemachten Feststellungen auch zu belegen, ist solchem Missbrauch Tür und Tor geöffnet.
Anstatt jede Sektion des Fragebogens einzeln zu diskutieren, anstatt sie alle einschließlich ihres Fragenkatalogs auf ihr Missbrauchspotenzial zu prüfen, haben wir unsere Bedenken und Eindrücke nach einmaligem Überfliegen des Formulars ChatGPT zur Auswertung vorgelegt.
Fragen des ZO an ChatGPT betreffend "Octagon"-Formular
Wir analysieren dieses Formular gemeinsam. Es ist das System "Octagon". Vielleicht kennst du es und weißt, wer es entwickelt hat? Es wird in der Schweiz von kantonalen Polizeikorps benützt, um Risiken von vermeintlich gefährlichen Personen zu beurteilen. Der Bewertungsrahmen soll dabei verschiedene Formen von Gewalt erfassen. Ziel sei es, den Handlungsbedarf und geeignete Maßnahmen vom Einzelfall abhängig zu ermitteln.
PROBLEMZONEN:
Lies es mal und identifiziere die Problemzonen, die entstehen, wenn Polizeibeamte, Justizvollzugsbeamte und Beamte eines Nachrichtendiensts (z.B. Abteilung für Extremismusbericht) Formulare
- über Zielpersonen der Personenüberwachung,
- über Deliktsverdächtige und auf andere Weise der Polizei zugeführte Personen (während Inhaftierung oder durch Nachforschung von Polizeibeamten)
ausfüllen aufgrund subjektiver Eindrücke und Beurteilungen.
RISIKEN & FRAGEN ZU RISIKEN:
Beurteile bitte als zweites das Risiko, das aus diesen Fragen und der Methode, diese Fragen zu beantworten (durch Ankreuzen eines Schweregrades nämlich), entsteht, dass Beamte einfach aus dem hohlen Bauch heraus, sozusagen "Handegelenk mal Pi", Behauptungen aufstellen, ohne diese Behauptungen näher zu begründen (es gibt keinen Platz auf dem Formular, um die Wahrnehmung konzise zu bezeichnen oder die Beurteilung zu begründen) und ohne einer etwaigen Archivierung oder Übermittlung des Formulars Belege für die Behauptungen und Einschätzungen beizulegen.
Welche Fragen müssten wir den parlamentarischen Kontrollkommissionen zur Verwendung dieses Formulars stellen, welche den politischen Exekutivverantwortlichen, um heraus zu finden,
wie die Korrektheit des Inhalts dieser Formulare überprüft (gewährleistet) wird, wie lange sie jeweils archiviert und von der Polizei bewirtschaftet (eingesehen) werden,
wie missbräuchliche Erfassung ... verhindert wird,
welche Akteneinsichtsrechte in solche Formulare bestehen und
inwiefern das EMRK-Grundrecht auf Privatsphäre verletzt wird?
SACHDIENLICHKEIT:
Drittens, beurteile bitte die Rubriken und ihre Fragen auf ihre Sachdienlichkeit bezüglich des Assessments "möglicher Gewalttaten".
KI-Analyse des Octagon-Formulars
Die von der OpenAI-KI erzeugten Antworten auf unsere obigen Fragen stellen wir als politische Diskussionsgrundlage im Folgenden öffentlich zur Verfügung:
Nachgedacht für 37s
Starkes Thema. Ich hab dein PDF „Octagon“ gründlich gelesen und binde dir die heiklen Stellen sauber in drei Blöcken auf. Wo sinnvoll, zitiere ich zusätzlich die Rechtsgrundlagen und die öffentliche Octagon-Version für Präzision.
Kurzfazit
Octagon ist ein strukturierter Versuch, Gewaltrisiken einzuordnen – aber die Ankreuz-Logik ohne Begründungsfelder, dehnbar formulierte Merkmale (Persönlichkeit, „Extremismus“-Nähe, Social-Media-Interessen), unklare Basisraten sowie fehlende Beleg-/Audit-Pflichten machen das System anfällig für Bias, Übergriffigkeit und Rechtsverletzungen. Ohne harte Verfahrenssicherungen kollidiert das schnell mit EMRK Art. 8 (Privatsphäre) und dem Schweizer DSG (revFADP). octagon-intervention.ch+2ECHR+2
1) Problemzonen beim Ausfüllen durch Polizei/Justiz/Nachrichtendienst
a) Ankreuzsystem ohne Begründungs-/Belegfeld
Das Formular verlangt, Merkmale als erfüllt zu markieren und „Flags“ (red/orange/yellow) zu setzen – ohne Pflicht zur kurzen Begründung, Quelle, Datumsangabe, Kontext. Das begünstigt Bauchentscheide, verhindert Nachvollziehbarkeit und erschwert nachträgliche Prüfung/Korrektur. (Instruktionen zur Flag-Setzung und Typologie, aber kein Pflichttextfeld).
b) Vage/weit auslegbare Merkmale
Beispiele: „Schwarz-Weiss-Denken“, „feindselig gegenüber Personengruppen“, „starkes Interesse an gewaltassoziierten Inhalten“, „Kontakt zur extremistischen Szene“, „querulatorische Muster“. Definitionsgrenzen fehlen; ohne operationalisierte Schwellen wird Alltagskonflikt schnell als Gefahrenindikator geframed
c) Politische/gesundheitliche Spezialkategorien
Rubriken zu Ideologie/Extremismus (politische Meinung), Psychose/Suizidalität/Substanzgebrauch (Gesundheitsdaten) sind besonders schutzwürdig. Ihre Erfassung per Checkbox ohne strikte Zweck-/Notwendigkeitsprüfung kollidiert mit DSG-Schutz der „besonders schützenswerten Daten“.
d) „Historisch“ vs. „aktuell“ bleibt schwammig
Das Formular fordert, bewusst eine Zeitgrenze zu ziehen – ohne Standard. Dadurch droht Vergangenheits-Overreach (alte Episoden werden zu stark gewichtet)
e) Basisraten werden verlangt – aber nicht geliefert
Octagon will, dass Fallführende Basisraten schätzen (z. B. 1/1000 auffällige Personen überschreiten die Schwelle). Ohne verbindliche Referenzen/Training führt das zu Pseudo-Präzision.
f) Eskalations-Szenarien/Management
Sinnvoll gedacht, aber auch hier keine Pflicht zur Evidenzverlinkung (z. B. Protokolle, Logs, Screenshots). Audit-Trail fehlt.
g) Teamcheck empfohlen – kein Muss
Die „10 Gebote“ predigen Teamarbeit und Falsifikation; das Formular erzwingt diese Qualitätsmechanismen aber nicht.
2) Risiko „Handgelenk × Pi“ (Ankreuzen statt begründen)
Hohe Gefahr systemischer Fehler, u. a.:
Confirmation Bias: Merkmal wird angekreuzt, weil es in die vorgefasste Hypothese passt; Gegenindizien verschwinden. Octagon mahnt zwar zur Falsifikation, sichert sie aber nicht prozessual.
Anchoring durch Flags: Ein früh gesetztes „red flag“ dominiert Folgebeurteilungen („labeling“).
Basisraten-Fehlschluss: Laienhafte Prozent-/Odds-Schätzungen wirken „objektiv“, sind es aber nicht, wenn Quellen fehlen.
Spezialkategorien ohne Schranken: Gesundheits-/Politik-/Sozialdaten werden eingetragen, ohne dokumentierte Notwendigkeit & Verhältnismässigkeit → Profiling-Risiko nach DSG & EMRK-Art. 8-Eingriff.
Weiterverwendung/Offenbarung: ECHR-Rechtsprechung zeigt, dass selbst zutreffende, aber nicht verurteilte Vorfälle in polizeinahen Registern unzulässig offengelegt sein können (Art. 8-Verstoss). Das unterstreicht die Notwendigkeit enger Leitplanken.
Bottom line: Ohne Pflicht-Begründungsfeld, Quellenangaben, Datierung, Verantwortungszeichnung und Peer-Review wird das Kreuzchen-System zu einer Meinungsdatenbank – für Betroffene kaum anfechtbar.
3) Fragenkatalog an parlamentarische Aufsicht & Exekutive
Rechtsgrundlage & Zweckbindung
a) Welche explizite Rechtsgrundlage (kantonales Polizeigesetz/Verordnung) erlaubt Octagon-Erfassung inkl. besonders schützenswerter Daten (Gesundheit, politische Meinung)? Bitte Artikel/Paragraph nennen. (Beispiel Kt. ZH PolG regelt Datenarten/Aufbewahrung). www2.zhlex.zh.ch
b) Wie wird Zweckbindung dokumentiert (Gefahrenabwehr vs. Strafverfolgung vs. Nachrichtendienst)? Cross-Use ausgeschlossen?
Datenqualität & Verfahren
c) Gibt es Pflichtfelder für Begründung/Quelle/Datum/Kontext zu jedem gesetzten Flag? Wenn nein: warum nicht?
d) Vier-Augen-Prinzip/Teamreview verpflichtend? Wie viele Fälle werden stichprobenartig auditiert?
e) Schulung/Zertifizierung der Anwender (Bias-Training, Basisraten, EMRK/DSG-Compliance) – Nachweis?
Aufbewahrung, Zugriff, Protokollierung
f) Aufbewahrungsdauer der Octagon-Formulare? Unterschiede: Fall ohne Delikt/ohne Verfahren? (Viele Kantone setzen 3–5 Jahre für diverse Polizeidaten; bitte kantonale Norm benennen.) bdlf.fr.ch
g) Zugriffsrechte (wer, wann, wozu), Zugriffslogs, Protokoll-Einsicht für Betroffene?
h) Datenweitergabe (an andere Kantone, fedpol/RIPOL, NDB) – auf welcher Grundlage, mit welcher Proportionalitätsprüfung?
Betroffenenrechte & Kontrolle
i) Auskunft/Berichtigung/Löschung/Sperrung: Wie üben Betroffene diese Rechte praktisch aus? (Beim Bund: fedpol bietet ein standardisiertes Auskunftsgesuch; was ist kantonal vorgesehen?) fedpol.admin.ch
j) Akteneinsicht: Fällt das Formular unter kantonales Verfahrensrecht oder unter Öffentlichkeitsgesetz/Informationszugang? (Bund: FDPIC vermittelt nach BGÖ – kantonal: Pendant?) edoeb.admin.ch
k) Beschwerdeweg bei Falschdaten oder Rechtsverletzung (Datenschutzaufsicht, Verwaltungsgericht, ggf. Strafanzeige)?
Missbrauchs-/Profiling-Schutz
l) Welche negativen Merkmalslisten sind verboten (z. B. Zugehörigkeit zu legalen politischen Gruppen ohne unmittelbaren Gewaltbezug)?
m) Trennwände zwischen Polizei/Nachrichtendienst? Rolle der parlamentarischen Kontrolldelegation (GPDel/CDel) bei systemischer Aufsicht? parlament.ch
Wirksamkeit & Transparenz
n) Gibt es Validitätsdaten: Trefferquote, False-Positive-Rate, Outcome-Tracking? Jährliche Transparenzberichte (anonymisiert, nach Deliktkategorien)?
4) Grundrechts- und Datenschutz-Einordnung (EMRK/DSG)
EMRK Art. 8 schützt Privat-, Familienleben und Kommunikation; Eingriffe sind nur zulässig „in accordance with the law“, notwendig und verhältnismässig. Octagon-Erfassungen sind Eingriffe und brauchen klare gesetzliche Grundlage, enge Zwecke, strenge Minimierung, Speicherlimits, Betroffenenrechte, wirksame Aufsicht. ECHR
revDSG (seit 1.9.2023) verlangt Transparenz, Zweckbindung, Datenminimierung, Korrektheit, Sicherheit; Gesundheits-, Straf- und Politdaten sind besonders schützenswert → höhere Schwelle und Privacy-by-Design. fedlex.admin.ch
ECHR-Linie: Zu breite polizeiliche Ermessensspielräume bei Offenlegung/Verwendung nicht verurteilter Sachverhalte verletzen Art. 8 (vgl. jüngst AR v UK, 2025). Lehre: klare Kriterien, enges „Need-to-know“, Rechtsmittel. thetimes.co.uk
5) Sachdienlichkeit der Rubriken für „mögliche Gewalttaten“
"2.1 Persönlichkeit (lebenslang)" – Gemischt
Kann relevante Muster adressieren.
− Viele Items sind unscharf/interpretationslastig; Gefahr der Pathologisierung von Dissens (z. B. Hostilität ggü. Gruppen) und Stigmatisierung. → Nur sachdienlich mit klaren Definitionen, inter-rater-Training, Belegpflicht.
"2.2 Psychische Vorbelastung" – Heikel
Relevanz bei akuter Störung kann hoch sein.
− Gesundheitsdaten; Checkbox-Logik ohne aktuelle Diagnostik → Overreach. Nur sachdienlich, wenn klinisch verifiziert, zeitlich eng und konkret deliktrelevant.
"2.3 Deliktische Vorbelastung/Dissozialität" – Sinnvoll mit Grenzen
Strafrechtliche Historie kann Prognose stützen.
− „Eingestellte Verfahren“ dürfen nicht leichtfertig als „plausibel“ gewertet werden – Unschuldsvermutung! Belege/Urteile beifügen.
octagon-intervention.ch
"2.4 Gewalt-Vorbelastung" – Kernnah
Direkter Prädiktor.
− „Geringe Hemmschwelle“ ist subjektiv, funktionsgebundene Gewalt (z. B. Einsatzkräfte) erfordert scharfe Angemessenheitsprüfung.
"2.5 Aktuelles Problemverhalten" – Sachdienlich bei enger Definition
Konkrete Vorbereitungshandlungen sind relevant.
− Formular warnt selbst: bloßes Interesse (Radikalisierungsinhalte) reicht nicht → Muss an plausible Eskalationshypothese geknüpft sein und belegt werden.
"2.6 Aktuelle psychische Belastung" – Nur mit Fachbezug
Akute Krisen können Schwellen senken.
− Checkbox ohne fachliche Beurteilung = Risikofiktion. Ärztliche/therapeutische Einschätzungen nötig.
octagon-intervention.ch
"2.7 Kontext des aktuellen Problemverhaltens" – Nützlich, aber breit
Lebensereignisse, Zugang zu Waffen etc. sind relevant.
− Weite Kontexte (Szene-Nähe, wirtschaftliche Lage) müssen konkret deliktrelevant gemacht und nicht politisch missbraucht werden.
"2.8 Reaktion auf behördliche Intervention" – Vorsicht Stufe
Non-Compliance kann Risiko signalisieren.
− „Fühlt sich moralisch im Recht“ ist wertend; Trennung zu legitimer Rechtsausübung (Beschwerde, Kritik) nötig.
"2.9 Typologische Einordnung" (et 3.x, 4.x Dringlichkeit/Flags) – Rahmen ja, Objektivität nein
Bringt Struktur in Managemententscheidungen.
− Ohne Green-/Blue-Flag-Belege und Outcome-Tracking nur Scheingenauigkeit.
6) Konkrete Mindest-Safeguards (ohne die ich Octagon nicht zulassen würde)
Pflicht-Freitext pro Flag (Beobachtung + Quelle + Datum + Kontext + Evidenzlink).
Vier-Augen-Review + periodische Team-Audits; Dokumentation im System.
Getrennte Layer für Spezialkategorien (Health/Politik) mit höherer Freigabeschwelle und strikter Zweckbindung.
Automatische Aufbewahrungs-Timer (kantonal normiert), Protokoll-Einsicht für Betroffene, jährliche Lösch-Reports. (Kantone teils 3–5 Jahre als Richtwert, aber verbindliche Normen abfragen.)
bdlf.fr.ch
Betroffenenrechte prominent (Auskunft/Berichtigung/Löschung) mit klaren Anlaufstellen; Verweis auf fedpol-Auskunft wo Bundessysteme betroffen sind. fedpol.admin.ch
Validierung/Wirksamkeit: Kennzahlen zu Trefferquote, False Positives, Interventions-Outcomes – jährlich veröffentlicht (anonymisiert).
Externe Aufsicht: Datenschutzaufsicht (kantonal/FDPIC) + parlamentarische Delegation bei NDB-Berührung; verpflichtende Compliance-Audits.
(ChatGPT-5)
Fazit: Bias, Übergriffikeit und Rechtsverletzungen
Die drei problematischsten Stellen des Octagon-Formulars, die am härtesten Missbrauch Tür und Tor öffnen, hat übrigens nicht ChatGPT als solche geflagged, sondern ein Mensch:
- In der Einleitung des Formulars halten seine Verfasser auf Seite 2 unter Punkt 8 fest: „Sehen Sie Fehlprognosen als Chance … Versuchen Sie, Informationen über den weiteren Verlauf beurteilter Fälle zu erfahren.“
Problematisch sind diese Zeilen insofern, als sie Beamte anstiften zu einer extralegalen Beschaffung sensibler Personendaten auf eigene Faust, ohne behördliche oder gerichtliche Anordnung. Damit besteht Gefahr, dass sie ungesetzlich die Privatsphäre missachten. Eine solche Form von extralegaler Bespitzelung ohne Rechtsgrundlage ist mit Sicherheit nicht EMRK-kompatibel. Sie könnte sogar als eine strafrechtlich relevante Form des Stalkings manifestieren oder zumindest von Betroffenen ohne Weiteres als Stalking erlebt werden, wenn sie Verfolgung bemerken (Psychoterror). ChatGPT hat diese Problematik nicht erwähnt. - Auf eine ähnliche Weise höchst problematisch ist der Abschnitt „2.7 Kontext des aktuellen Problemverhaltens“: „Es geht darum, den Lebenskontext auf Faktoren zu untersuchen, die eine Gewaltanwendung begünstigen.„ „Lebenskontext“ eröffnet hier einen extrem dehnbaren Hintereingang für umfassende Überwachung und Profilierung bzw. Beschaffung von privaten Personendaten. Es fehlen indes klare Rechtsgrundlage und nachvollziehbar ausgewiesener Bedarf. Auch hier ist Zweckentfremdung und Missbrauch Tür und Tor geöffnet.
- Die problematischste Passage finde sich jedoch schon in Abschnitt 2.4, im Hinweis auf die Informationsquellen, auf die sich die Behörden abstützen sollen: „Die Prüfung der Angemessenheit der Gewaltanwendung sollte sich aber nicht (nur) auf formaljuristische Kriterien abstützen.“
Was wohl „formaljuristische Kriterien“ hier im Klartext bedeuten? Es könnte bedeuten, dass gerichtliche Beurteilungen von Gewaltanwendungen (beispielsweise die gerichtliche Beurteilung einer Gewaltanwendung als legitime Notwehr) als Folge dieses Passus für Polizeibeamte irrelevant würden, wenn sie anderer Meinung wären als das Gericht. Geradezu eine Einladung zu Bias, Übergriffikeit und Rechtsverletzungen.
Hier muss unbedingt eine Präzisierung angebracht werden, was unter „formaljuristische Kriterien“ genau gemeint ist und was nicht. Denn hier sind Verletzungen des Rechts auf ein faires Verfahren gem. Art. 6 EMRK vorprogrammiert. Aber auch Verletzungen des Rechts auf Unversehrtheit drohten, wenn die Beamten vermittels dem Octagon-System einem Menschen zwar unrechtmäßig aber deswegen nicht minder faktisch das Recht auf Selbstverteidigung absprechen.
Der die Verantwortung trägt...
Als gefährlich anzusehen sind Personen wie die Forensiker, die - sehr wohlbewusst, was sie tun - auf leisen Sohlen einen bewährten Rechtsstaat in einen unberechenbaren Polizeistaat umzufunktionieren drohen.
Wer Breitbandspektrum-Tools zur Überwachung wie das "Octagon"-System schafft, das sich mangels strikter Richtlinien für die Anwendung und mangels strikter Beweisführung und Kontrolle der Einträge ohne Weiteres zur missbräuchlichen Überwachung aller nur irgendwie von streng bürgerlichen Normen abweichenden Menschen zweckentfremden ließe, macht sich mitschuldig am Aufbau eines Überwachungsapparats, der per se, immer, in den Totalitarismus abzudriften prädestiniert ist. Denn haben die Mächtigen erst einmal die Tools, politisch missliebige Stimmen STASI-mäßig zu gängeln, zu diskreditieren, zu jagen, dann werden die Mächtigen sich noch so gerne dieser Tools bedienen.
Gerade als qualifizierte Psychologen und Psychiater müssten die Urheber des Octagon-Systems dies denn auch ganz genau wissen. Deshalb sind sie umfassend in die Verantwortung zu nehmen für die "Betriebssicherheit" ihres Systems - und damit für allfällige Missbräuche.
Was für eine Geschichte des Verbrechens die Psychiatrie im Dritten Reich, im kommunistischen Osteuropa und durchaus auch im freien Westeuropa geschrieben hat, ist in der Mainstream-Presse zwar längst untergegangen. Aber noch leben genug Menschen, die sich auch daran erinnern. Und es gibt genug geschichtsbewusste Menschen in dieser Gesellschaft, die darüber orientiert sind. Es sind insbesondere eine ärztliche Pfuschkultur und ärztliche Machtallüren, auf deren Konto viele dieser Verbrechen gingen.
Was hier mit Octagon, FOTRES etc. vorliegt: ein großer Menschenversuch mehr der Psychiatrie, den sie an unfreiwilligen Proband:innen teils ohne deren Wissen, insbesondere ohne Rechtsgrundlage und in vielen Fällen ohne jede sachliche Begründung vornimmt. Notorisch. Die Psychiatrie notorisch.
Unser Tipp: Leisten Sie Widerstand gegen unrechtmäßige Überwachung - so lange Sie können. Greifen Sie zu verhältnismäßigen Mitteln, aber wehren Sie sich effektiv. Schließen Sie sich zu Bürgerbewegungen zusammen und leisten Sie Widerstand!
Denn in einem totalitären psychiatrischen Apparat sitzen Sie schneller mit gebundenen Händen fest als Sie wieder heraus kommen - wenn Sie da jemals wieder heraus kommen.
Anhang
Eine Ultrakurzzusammenfassung auf 1 Seite A4 dieser Auseinandersetzung der KI mit dem Octagon-System gibt es als PDF:
Für parlamentarische und behördliche Hearings zum Thema „Octagon“ läge ein seitens ChatGPT großzügigerweise erstellter konziser Fragenkatalog ebenfalls als PDF vor:
Der Vollständigkeit halber zum Schluss unsere persönlichen Notizen zum Octagon-Formular, bevor wir schließlich die weitere Analyse an ChatGPT übergaben:
Medienberichte: Drei Schweizer Medien berichteten 2019 und 2020 über das Octagon-System – seither Funkstille
Schon 2014 berichtete das Schweizer Onlinemagazin watson.ch (FixxPunkt AG) unter dem Titel „Schweizer Polizisten sagen mit Spezial-Software Verbrechen punktgenau voraus. Nachfragen sind unerwünscht„, dass in Zürich und Basel „der Computer Einbrüche mit wissenschaftlicher Präzision“ prognostiziere. Der damalige Bericht von Daniel Schurter über die Prognose-Software „Precobs“ erwähnte das Octagon-System indes noch nicht. Doch schon damals stellte watson.ch den Behörden ein schlechtes Zeugnis aus bezüglich Transparenz: „Es stellen sich viele Fragen – die Verantwortlichen ‚mauern'“, und im Titel: „Nachfragen sind unerwünscht“.
Am 18. Dezember 2019 berichtete im Züricher „Tages-Anzeiger“ (Tx Group, vormals Tamedia AG) Patrice Siegrist unter dem Titel „Mit 50 Fragen Gewalttäter erkennen“ über ein System, bei dem die Züricher Polizei „mit einer Web-App“ arbeite, die Gewalt verhindern helfen soll. Es handelt sich um den ersten Medienbericht über das Octagon-System. Allerdings berichtete der Tages-Anzeiger nicht besonders kritisch sondern in seiner für Medien der Tx Group (vormals Tamedia AG) charakteristischen, gegenüber Autoritäten syncophantischen Art.
„Die Republik„ (Project R Genossenschaft) titelte am 11. Dezember 2020 über dem Artikel von Adrienne Fichter und Florian Wüstholz: „Die Polizei weiss, was Sie morgen vielleicht tun werden“.
Im Lead alarmieren sie: „Die Schweiz ist eine Pionierin im Einsatz von Software, die voraussagt, wer wann wo ein Verbrechen begehen könnte. Doch die Tools sind weder rechtlich noch demokratisch legitimiert.“ Der Artikel verweist auf eine Studie der Universität St. Gallen und verlinkt diese (der Link führt heute ins Leere). Als key takeways hält der Artikel fest:
- „Die Schweiz ist im deutschsprachigen Raum Pionierin für Predictive Policing. Immer mehr sogenannte «Gefährder» werden in Datenbanken erfasst, in der eigenen Wohnung aufgesucht und angesprochen, beobachtet, überwacht.“
- „Es gibt keine öffentliche Debatte über Predictive-Policing-Programme und auch keine Regulierungen. Nur wenige wurden von unabhängiger Seite evaluiert. Für viele Polizeibeamtinnen ist nicht nachvollziehbar, wie die Programme funktionieren. Die Algorithmen sind Geschäftsgeheimnis der Anbieter, und die Daten liegen teilweise auf Servern im Ausland.“
- „In einigen Kantonen wurden jahrelang digitale Prognostikprogramme und Präventivmassnahmen im rechtsfreien Raum angewendet. Gefährderdatenbanken wurden ohne rechtliche Grundlage angelegt.“
Die „Schaffhauser AZ„ (AZ Verlags AG), in Zusammenarbeit mit der „Republik“, titelte ebenfalls am 11. Dezember 2020 nüchtern über dem Artikel von Matthias Greuter: „Präventive Überwachung im rechtsfreien Raum“. Der Artikel stellt fest: „Für das Bedrohungsmanagement fehlt die gesetzliche Grundlage.“ Dazu führt er aus: „Im Jahr 2017 wollte die Regierung das Polizeigesetz überarbeiten und – unter anderem – das Bedrohungsmanagement rechtlich untermauern – mit grosszügigen neuen Kompetenzen für die Polizei. Das neue Polizeigesetz scheiterte aus anderen Gründen letztlich bereits in der Vernehmlassung, ein neuer Entwurf lässt auf sich warten. Aber: Nichtsdestrotrotz arbeitet das Schaffhauser Bedrohungsmanagement bereits, holt Informationen über ‚Gefährder‘ ein, erhebt Daten – auch mit einem Vorhersage-Tool Namens ‚Octagon‘ – und teilt sie mit anderen Behörden.“
Begeisterung der Züricher Exekutive
Dass die Schweizer Politik oder wenigstens einzelne Parteien sich mit der Thematik des „Predictive Policing“ und konkret auch mit „Octagon“ in der Vergangenheit beschäftigt hätten oder sich aktuell beschäftigen würden, ließ sich nicht erstellen und auch vorliegenden Zeitungsberichten nicht entnehmen. Man lässt die Exekutive kücheln?
Am Status quo, den die „Republik“2020 festgestellt hatte, scheint sich bis heute nichts geändert zu haben: „‚Politischen Widerstand gab es nie‘, erzählt uns eine Polizistin. ‚Wir nehmen den Politikern auch viel Arbeit ab.'“
NB: Die STASI hat dem SED-Regime auch "viel Arbeit abgenommen".
Die Staatskanzlei des Kantons Zürich widmet im „Schlussbericht vom 28. Februar 2021 zum Vorporjekt IP6.4“ unter dem Titel „Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Verwaltung: rechtliche und ethische Fragen“ auf Seite 25, Ziffer 3. „Polizeiarbeit“, litera a „Predictive Policing“ bewusster Thematik knappe Ausführungen und erwähnt Octagon als Eigenentwicklung des Züricher Justizvollzugs.
Zur Prognosesoftware „Precobs“ äußert sich der Bericht wie folgt:
„In der Schweiz betreiben die Kantonspolizeien Aargau und Basel-Landschaft sowie die Stadtpolizei Zürich ortsbezogenes Predictive Policing mit der kommerziellen, in Deutschland
entwickelten Software PRECOBS. Die Software wird in der Schweiz zurzeit ausschliesslich zur Bekämpfung von Wohnungseinbruchsdiebstählen eingesetzt. Allerdings ist die Anwendung auf weitere Deliktstypen grundsätzlich möglich und zurzeit in Planung.125 PRECOBS basiert auf der kriminologischen Near-Repeat-Theorie, welche besagt, dass professionelle Einbrecher häufig serienmässig arbeiten und damit örtlich und zeitlich konzentriert zuschlagen.126 Dieses Phänomen soll genutzt werden, um Vorhersagen über erhöhte Wahrscheinlichkeiten für Wohnungseinbrüche in bestimmten Gebieten zu bestimmten Zeiten zu treffen.127 Im Juni 2020 hat auch der Kanton Basel-Stadt ein Projekt zur automatisierten Analyse von
Lagedaten in Auftrag gegeben, wobei ebenfalls Predictive Policing-Anwendungen geprüft werden sollen.“
In Zusammenhang mit „Octagon“ äussert sich der Bericht euphorisch:
Sechs Kantone (Glarus, Luzern, St. Gallen, Solothurn, Thurgau und Zürich) arbeiten (bzw. arbeiteten im Falle Zürichs) mit dem Analysetool DyRiAS-Intimpartner. Das Tool analysiert das Risikopotenzial einer männlichen Person, ein Gewaltdelikt gegen die aktuelle oder ehemalige Partnerin zu begehen. Das Tool gibt auf der Grundlage eines beantworteten Fragekatalogs eine Risikoeinschätzung ab, ob die Person eine schwere Gewalttat gegen die Partnerin begehen wird. Neuerdings kann das System zusätzlich auch Handlungsoptionen für das Fallmanagement aufzeigen. Während DyRiAS aus einer Stichprobe mit Daten von tatsächlich straffällig gewordenen Gewalttätern zwar 82 Prozent der Täter in den beiden höchsten Risikostufen einordnete, verübten jedoch nur 28 Prozent der von DyRiAS als gefährlich eingestuften Personen tatsächlich ein Gewaltdelikt. DyRiAS arbeitet folglich mit einer Risikoüberschätzung. Im Frühjahr 2018 präsentierte der Kanton Zürich Octagon, ein Programm, welches das gleiche Ziel wie DyRiAS verfolgt. Auch die Funktionsweise erscheint ähnlich, sie ist aber eine Eigenentwicklung des für Justizvollzug und Wiedereingliederung zuständigen Amtes und soll das Risiko deutlich realistischer einschätzen. Dabei handelt es sich auch um eine Reaktion auf die Probleme, welche DyRiAS aufgeworfen hat. Mittlerweile sollen auch die drei Kantone Solothurn, Neuenburg und Tessin mit dem Tool arbeiten.
Allerdings: die im Titel der Publikation angekündigte Auseinandersetzung mit „rechtlichen und ethischen Fragen“ suchen wir zum Thema „Predictive Policing“ vergeblich. Stattdessen hält sie auf Seite 11 zu „Eingrenzung und Zielgruppen“ fest:
„In der vorliegenden Studie sollen die rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen eines KI-Einsatzes in der öffentlichen Verwaltung thematisiert und Vorschläge dazu für den Kanton Zürich entwickelt werden. Die untersuchten Bereiche der Verwaltung wurden von den Autorinnen und Autoren weiter konkretisiert, um eine vertiefte Analyse der ethischen und rechtlichen Herausforderungen zu ermöglichen. Unberücksichtigt blieb daher einerseits der Einsatz von KI in der medizinischen Diagnostik, da dies kein hoheitliches Handeln der Verwaltung im klassischen Sinne darstellt. Anderseits wurde weitgehend auf Ausführungen zum Predictive Policing verzichtet, da diese KI-Technologien bereits mehrfach untersucht worden sind und die juristischen Vorgaben zudem sehr spezifisch und insoweit nicht für weitere Zweige der kantonalen Verwaltung anwendbar sind. Allerdings wird im Rahmen der Auslegeordnung (Status-quo-Recherche) von KI-Anwendungen in der Schweiz aufgrund ihrer weiten Verbreitung auf Predictive Policing eingegangen.“
Die Behauptung des Berichts, dass Predictive Policing „bereits mehrfach untersucht worden“ und die „juristischen Vorgaben zudem sehr spezifisch“ seien, widerspricht allerdings diametral dem Befund der Medien. Zur Rekapitulation die key takeaways der „Republik“ vom 11. Dezember 2020: „Es gibt keine öffentliche Debatte über Predictive-Policing-Programme und auch keine Regulierungen. Nur wenige wurden von unabhängiger Seite evaluiert. Für viele Polizeibeamt:innen ist nicht nachvollziehbar, wie die Programme funktionieren. Die Algorithmen sind Geschäftsgeheimnis der Anbieter, und die Daten liegen teilweise auf Servern im Ausland.“ Wie sollte „Predictive Policing“ der Züricher Verwaltung da als „bereits mehrfach untersucht“ gelten und die juristischen Vorgaben als „zudem sehr spezifisch“? Die Publikation der Staatskanzlei spricht sich mit diesem Widerspruch jede Wissenschaftlichkeit ab – oder straft die Medien Lügen.
Die einzigen kritischen Erwägungen zum „Predicitve Policing“ finden wir an der einzigen weiteren Stelle, an der die Publikation dieses erwähnt. Auf Seite 40 betreffend „rechtliche Rahmenbedingungen für den staatlichen KI-Einsatz im Kanton Zürich“, Kapitel „III. Diskriminierungsverbot“, 2. Abschnitt über „Diskriminierungsverbot und KI“, zitiert die Publikation zu „möglichen Diskriminierungsquellen in KI-Systemen“ konkret:
„Das Diskriminierungspotenzial wird in der Literatur besonders im Zusammenhang mit Predictive Policing diskutiert. So ist etwa bekannt, dass sich Vorurteile der Polizistinnen und Polizisten in der Auswahl der zu kontrollierenden Orte niederschlagen können. Nutzt man solche Orte als Trainingsdaten, können dadurch Verzerrungen entstehen.
Ein präexistierender Bias kann aber auch von Systementwicklerinnen und -entwicklern ausgehen. Das Design eines jeden Artefakts ist an sich eine Ansammlung von Entscheidungen, angefangen bei den zu berücksichtigenden Eingaben bis hin zu den mit dem System verfolgten Zielen. Ist das Ziel eine grösstmögliche Effizienz oder sollen auch die Wirkungen auf Menschen und die Umgebung berücksichtigt werden? Ist es das Ziel des Systems, so viele potenzielle Betrügerinnen und Betrüger wie möglich zu finden, oder soll die Überwachung von unschuldigen Personen möglichst vermieden werden? Solche Entscheidungen werden auf die eine oder andere Weise von den inhärenten Vorurteilen der Personen, die sie treffen, bestimmt.“
Die Schlussfolgerungen, die die Autoren der Publikation der Züricher Staatskanzlei auf Seite 41 ziehen („grosses Diskriminierungspotenzial durch KI“), ließen sich 1:1 auf die Probleme der human intelligence mit Systemen wie Octagon übertragen:
KI-Anwendungen benötigen (quantifizierbare) Daten, die für das System bearbeitbar sind. Geht es darum, mithilfe von KI-Anwendungen eine personenbezogene Entscheidung zu treffen, ist zu bedenken, dass auf einer solchen Datengrundlage lediglich ein fragmentarisches Bild einer Person entstehen kann. Diese Lückenhaftigkeit in der Beurteilung von Personen
anhand von wenigen verfügbaren Informationen stellt zwar kein KI-spezifisches Problem dar. Dennoch wird in der Literatur auf das Risiko der Entstehung eines sogenannten digitalen Positivismus hingewiesen, wonach KI-Systeme so interpretiert werden, als würden sie die Realität abbilden bzw. transparent machen und nicht mehr kritisch hinterfragt werden. Dadurch
entsteht die Gefahr, dass KI-basierte Empfehlungen unhinterfragt übernommen werden, auch wenn sie unter Umständen zu einer Diskriminierung führen.
Die Exekutive scheint begeistert. Uns würde indes interessieren, welche politischen Parteien im Kanton Zürich sich aktiv mit dieser Thematik auseinandersetzen, dazu eine klare Haltung entwickelt haben und diese auch offiziell und verbindlich einnehmen. Alle d'accord mit dem Status quo? Unisono? Unisono wie eine SED?
Update folgt, sobald wir mehr wissen. Bei wem wir nachgefragt haben, entnehmen Sie unserem Email vom 7. November 2025 an politische Parteien im Kanton Zürich. Eingehende Antworten auf diese Anfrage werden nachfolgend in der Reihenfolge ihres Eingangs verlinkt:
- EDU (10.11.2025)
Fußnote
- AW AlgorithmWatch, 10115 Berlin (Selbstbeschreibung: „AlgorithmWatch ist eine gemeinnützige Nichtregierungsorganisation in Berlin und Zürich. Wir setzen uns dafür ein, dass Algorithmen und Künstliche Intelligenz (KI) Gerechtigkeit, Demokratie, Menschenrechte und Nachhaltigkeit stärken, statt sie zu schwächen.“) ↩︎